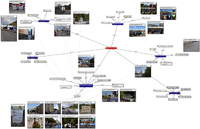Manage: Unterschied zwischen den Versionen
| (75 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{DISPLAYTITLE:Manage}} | {{DISPLAYTITLE:Manage}} | ||
Dem Veranstalter als hauptverantwortlichem Akteur obliegen in der Eventphase zentrale kommunikative Aufgaben. Neben der Unterweisung und Koordinierung eigener sowie | [[Datei:managen.png|200px|thumb|right|Der Manage-Prozess einer Großveranstaltung]] | ||
Dem Veranstalter als hauptverantwortlichem Akteur obliegen in der Eventphase zentrale kommunikative Aufgaben. Neben der Unterweisung und Koordinierung eigener sowie beauftragter Kräfte gilt es insbesondere, einen steten Informationsaustausch mit den eingesetzten BOS und den Besuchern zu etablieren sowie aufrecht zu erhalten, um ein aktuelles und einheitliches Lagebild an allen erforderlichen Stellen gewährleisten zu können. Bei der Durchführung einer Veranstaltung sind also nicht nur interne, sondern auch externe Kommunikationsobligationen zu beachten.<ref>Dies gilt insbesondere im Krisenfall. Siehe hierzu [[Sicherheitsbausteine/Kommunikationskonzept#Krisen-_.2F_Schadensbetrieb|''Krisenbetrieb in der internen Kommunikation'']] sowie [[Sicherheitsbausteine/Kommunikationskonzept#Krisen-_.2F_Schadensbetrieb_2|''Krisenbetrieb in der externen Kommunikation'']]</ref> Darüber hinaus darf zu keinem Zeitpunkt der Informationsbedarf der Besucher außer Acht gelassen werden, der gemeinsam mit gezielten Maßnahmen des ''Mood-managements''<ref>Zur Einführung: Batinic, B.; Appel M.: Mood Management. In: ''Medienpsychologie''. Heidelberg: Springer Medizin 2008, S. 117-118. Weiterführend siehe z. B.: Oliver, M. B.: Mood management and selective exposure. In: Bryant, J.; Roskos-Ewoldsen, D.; Cantor, J. (Hg.): ''Communication and emotion: Essays in honor of Dolf Zillmann''. New York: Routledge 2012, S. 85–106.</ref> ein wichtiger Ansatzpunkt für die Beeinflussung der Stimmung und damit für die Gewährleistung der Veranstaltungssicherheit ist. Anregungen können und sollten in diesen Punkten auch aus einschlägiger Literatur zur ''Event-Kommunikation''<ref>Wünsch, U; Thuy, P. (Hg.): ''Handbuch Event-Kommunikation: Grundlagen und Best Practice für erfolgreiche Veranstaltungen''. Berlin: Erich Schmidt 2007.</ref> bezogen werden. Die zentralen Aufgaben des Veranstalters in der Eventphase sollen im weiteren Verlauf für eine strukturierte Darstellung der jeweiligen Kommunikationsobligationen und -Möglichkeiten als Orientierungspunkte dienen. | |||
{| class="wikitable float-left" | |||
!Wer | |||
!Mit Wem | |||
!Was | |||
!Wie | |||
!Mit welchem Effekt | |||
|- align="left" valign="top" | |||
| Veranstalter || BOS<br>(Polizei<br>Feuerwehr<br>Rettungsdienst...) || Abstimmung, Koordination, Planung, (Lage-)Informationen, Risikoeinschätzung || <u>Maßnahmen</u><br>Besprechungen, Treffen, Vor-Ort-Termine, Soft- und Hardwarelösungen<br><u>Medien</u><br>F2F-Kommunikation, Telefon, Funk, Durchsagen, E-Mail, Software-Plattformen<ref>vgl. http://www.uni-siegen.de/fb5/wirtschaftsinformatik/paper/2013/crisisprevention2013_sicherheitsarena.pdf</ref>, (integrierte) Messenger-Dienste || geteilte, aktuelle Lageinformation, Gewährleistung der Veranstaltungssicherheit | |||
|- align="left" valign="top" | |||
| Veranstalter || Dienstleister<br>Eigenes Personal<br>Ordnungsdienst<br>Brandsicherheitswache<br>Sanitätsdienst || Organisatorische Belange, Informationen zur Veranstaltungsordnung, Koordination, (Lage-)Informationen || <u>Maßnahmen</u><br>Besprechungen, Treffen, Vor-Ort-Termine, Soft- und Hardwarelösungen<br><u>Medien</u><br>F2F-Kommunikation, Telefon, Funk, Durchsagen, E-Mail, Software-Plattformen, (integrierte) Messenger-Dienste || geteilte, aktuelle Lageinformation, Gewährleistung des Veranstaltungsablaufs, effiziente Koordination von Arbeitskräften | |||
|- align="left" valign="top" | |||
| Veranstalter || Besucher || Identitätsmanagement, Informationen zur Veranstaltungsordnung, Mood-management || <u>Maßnahmen</u><br>Events & Aktionen, Merchandising, Durchsagen, Befragungen, Studien, Beacons<ref>Beacons sind kleine Sender, die auf dem Veranstaltungsgelände installiert und unabhängig vom Mobilnetz (via Bluetooth) situations- und ortsabhängige Nachrichten an Endgeräte von Besuchern und Einsatzkräften in einem bestimmen Umkreis (ca, 30m, abhängig von baulichen Gegebenheiten) übermitteln können.</ref><br><u>Medien</u><br>Print, TV, Radio, Social Media, Blogs, Foren, E-Mail, Megafon, Apps, SMS, Beschilderung, Banner, Flyer, Videowalls || informierte Besucher mit erhöhter Selbstkompetenz, Sicherstellung eines geregelten Veranstaltungsablaufs | |||
|} | |||
==Identität managen== | ==Identität managen== | ||
[[Datei:ANNA20130730 (92).JPG|200px|thumb|right|Werbeplakat der Annakirmes 2013]] | |||
*Image von Veranstalter und Veranstaltung als Faktor für Veranstaltungssicherheit: Gilt Festival/Kirmes/Sportevent als sicher? | |||
*Sicherheitsgefühl beim Besucher zentrales Element für tatsächliche Sicherheit → Maßnahmen des Mood-Managements durch Veranstalter durchzuführen: | |||
**Einbindung der Künstler in die Veranstaltungskommunikation: direkte Ansprache der Besucher durch Künstler, bspw. zu positiven Erfahrungen mit der Veranstaltung | |||
**freundliches und hilfsbereites Personal, das das Gefühl vermittelt, gut aufgehoben zu sein | |||
**weitestmöglich offene und aktuelle Informierung der Besucher zu Begebenheiten, Entwicklungen, Vorhaben | |||
**redundante Verweise auf möglicherweise vorhandene Sicherheitszertifikate von Veranstalter und/oder Veranstaltung | |||
**Gezielter Einsatz von stimulierenden sowie entspannenden Medien (bspw. Musik), um auf die Besucherstimmung Einfluss zu nehmen | |||
*Identitätsmanagement besteht aus mehr als PR und Marketing, es ist ein Instrument zur aktiven Konstruktion von Sicherheit | |||
*''wichtigste Medien: Social Media, TV, Radio, Print'' | |||
===Networken=== | ===Networken=== | ||
*Kontakte mit lokalen und überregionalen Medien, zur Sensibilisierung der Besucher gegenüber Sicherheitsthemen → Veranstaltungsinformationen immer auch Sicherheitsinformationen | |||
*Profilierung als sicherheitsbewusster Veranstalter bzw. sicherheitsbewusste Veranstaltung auch gegenüber einer breiteren Öffentlichkeit | |||
*Kontakt mit Stakeholdern, Unternehmen und Kommunen zur Organisation von Budgets, Incentives und sonstigen Hilfestellungen zur Förderung von Sicherheits-PR auf dem und um das Veranstaltungsgelände | |||
===Betreiben von Marketingmaßnahmen=== | ===Betreiben von Marketingmaßnahmen=== | ||
*''Customer-Relationship-Management'' (CRM)<ref>vgl. z. B. Bruhn, M.: ''Kundenorientierung: Bausteine für ein exzellentes Customer Relationship Management.'' München: C.H.Beck 2012.</ref>, Corporate Identity und Merchandising als Instrumente für Sicherheitsbotschaften<ref>für allgemeine Hinweise zu veranstaltungsbezogenen Marketingmaßnahmen siehe z. B. Sokkar, S.: Eventmarketing - theoretischer Teil, in: Dannhäuser, R., Hrsg., ''Eventkommunikation''. Stuttgart: Deutscher Sparkassen Verlag 2008, S. 15-42.; Schaumlöffel, M.: Marken erleben: Signalisation, Emotion, Interaktion und Information im Eventmarketing, ebd., S. 75-112 und Klein, C.: ''Eventmanagement in der Praxis''. Bonn: interna 2008.</ref>: | |||
**Notfallkontakte, Warnungen und Orientierungshilfen auf Plakaten, Bannern, Tickets und in den sozialen Medien | |||
**gezielte Nutzung von Social Media Kanälen um deren Reichweite zu erhöhen und so in Notfällen ggf. mehr erreichen zu können | |||
**Veranstaltungsbezogene Audio- und Video-Botschaften mit Sicherheitsthemen kombinieren bzw. flankieren | |||
**Nutzung aller Möglichkeiten zur Inszenierung der temporären Veranstaltungsgemeinschaft als sicherheitsbewusste Gemeinschaft | |||
*Nutzung aller Möglichkeiten zur aktiven Einbindung der Besucher und Steigerung deren Selbstkompetenz: | |||
**gemeinsame Sicherheitsübungen zu Beginn des Events (analog zu Flug- und Seereisen) | |||
**Einbindung von Besuchern durch Hilfstätigkeiten und (Gewinn-)Spiele mit Incentives | |||
===Marke entwickeln=== | ===Marke entwickeln=== | ||
*Nachhaltige Positionierung der Veranstaltungsmarke: Sicherheit als Mehrwert | |||
*Lokale Präsentation mithilfe von Zertifikaten etc. nachvollzieh- und nachprüfbar machen | |||
===Veranstaltungscharakter/Atmosphäre schaffen=== | ===Veranstaltungscharakter/Atmosphäre schaffen=== | ||
*kompetentes Personal für Fragen von Besuchern vorhalten | |||
*ausreichende Beschilderung aller sicherheitsrelevanten Einrichtungen (Notausgänge, Sanitätsstationen, Feuerwehrwachen, Mobile Polizeiwachen usw.) | |||
*Beleuchtung der Beschilderung | |||
==Personal managen== | ==Personal managen== | ||
*Steuerung eigener Kräfte sowie Koordinierung von Ordnungs-, Sanitätsdienst und Brandsicherheitswache sowie weiterer Dienstleister | |||
*Einsatz von Softwarelösungen zum Veranstaltungs- bzw. Projektmanagement mit Messaging-Schnittstellen, Logbuchfunktion und Rückfallebenen → Unterstützung bei der gerichtsfesten Dokumentation eigenen Handelns | |||
*Gebot eindeutiger und verständlicher Formulierungen | |||
*''wichtigste Medien: F2F-Kommunikation, Telefon, Funk, Software-Plattformen, (integrierte) Messenger-Dienste'' | |||
===Unterweisen=== | ===Unterweisen=== | ||
*adäquate Vorbereitung des Personals auf jeweilige Aufgaben durch verbindliche Verwendung einheitlicher, eindeutiger und klarer Begrifflichkeiten während der Veranstaltung | |||
*Verwendung eines permanenten Feedback-Kanals für Rückfragen | |||
*„Fehlerkultur“: falsches Verhalten nicht sanktionieren, sondern Eigenständigkeit und Selbstlernkompetenzen gezielt fördern | |||
===Motivieren=== | ===Motivieren=== | ||
*nachhaltige Festigung sicherheitsbewussten Verhaltens durch: | |||
**angenehmes Arbeitsklima | |||
**o. g. Fehlerkultur sowie dezidiertes Fehlermanagment: | |||
***gemeinsame Besprechung von Fehlverhalten oder –Entwicklungen | |||
***Einsammeln von Verbesserungsvorschlägen aus der Belegschaft | |||
***Rückinformation an Personal über die daraus resultierenden Veränderungen | |||
**Anreize schaffen für besonders vorbildliches Verhalten | |||
===Einsetzen=== | ===Einsetzen=== | ||
*Kriterien für aus sicherheitskommunikativer Sicht adäquaten Personaleinsatz: | |||
**individuelle kommunikative und informationelle Fähigkeiten | |||
**Erfahrung u. Kenntnisse der örtlichen Begebenheiten (evtl. Einsatz von Lotsen) | |||
===Anpassen=== | ===Anpassen=== | ||
*verlässliche Push- und Pull-Informierung der beteiligten Akteure zu aktuellen Entwicklungen | |||
*aktuelle Besucher-Information zu laufenden Anpassungen | |||
===Entwickeln=== | ===Entwickeln=== | ||
*Change Management und Change Kommunikation bspw. durch: | |||
Qualität managen | **Mentoring-Modelle (gemeinsamer Einsatz von unerfahrenem und erfahrenem Mitarbeiter) | ||
**Beteiligung des Personals an Konzeptentwicklung und Evaluation mittels Umfragen, Interviews usw. | |||
**Testen neuer Qualitätsmerkmale → [[Manage#Testen|Testen]] | |||
==Qualität managen== | |||
*Evaluation vollzogener Maßnahmen durch: | |||
**Enge Verzahnung der kommunikativen Schnittstellen von eigenem Personal und (Sicherheits-)Dienstleistern | |||
**Erhebung von Besuchermeinungen mithilfe von Fragebögen, Interviews sowie Testszenarien | |||
**Einbindung eigenen Personals → [[Manage#Entwickeln|Entwickeln]] | |||
*''wichtigste Medien: Software-Plattformen, (integrierte) Messenger-Dienste, Funk, Telefon, Social Media, Apps, Foren'' | |||
===Lage konstruieren=== | ===Lage konstruieren=== | ||
Der Prozess der Lagekonstruktion verwendet bewusst den Begriff konstruieren. Alle Verantwortlichen müssen sich fortwährend vergegenwärtigen, dass das jeweils aktuelle Lagebild keine objektive Gegebenheit unter Berücksichtigung aller relevanten Faktoren ist, sondern eine von i.d.R. mehreren Akteuren unternommene Konstruktion. Eine vollkommene Reziprozität mit den tatsächlichen Gegebenheiten wird sich dabei kaum erreichen lassen, jedoch können die folgenden Punkte hilfreich für eine Annäherung sein: | |||
*Vernetzung aller relevanten Akteure mit Veranstalter als Koordinierungszentrum → idealerweise permanent besetzte Leitstelle mit Vertretern aller Akteure | |||
*wechselseitige Informationsweitergabe nach den Prinzipien Bottom-Up und Top-Down (Beschaffung und Weitergabe aktueller Lageinformationen durch Personal auf dem Gelände (Lageinformationen weitergeben) sowie Sammlung, Verarbeitung, Auswertung und Rückspiegelung in Form von Benachrichtigungen und Anweisungen durch Veranstalter) | |||
*unterstützender Einsatz von Softwarelösungen zur Vernetzung und Dokumentation des Veranstaltungsmanagements | |||
*relevante Kenngrößen sind z. B. Wetter, Besucheranzahl und -Bewegung, Stimmung, Verfügbarkeit von Ressourcen | |||
===Messen der Leistungsqualität=== | |||
*fortlaufendes Controlling der Qualität angebotener Leistungen sowie Zusammenführung, Verarbeitung und Auswertung der erhobenen Daten beim Veranstalter in den Bereichen: Ressourcenqualität, Warteschlangenzeiten, Besucherzufriedenheit sowie Qualität von Dienstleistern, ggf. Künstlern, BOS | |||
*Umsetzbar mit Überprüfungen, Befragungen usw. | |||
===Testen=== | ===Testen=== | ||
*Einholen eines aktuellen Meinungs- bzw. Stimmungsbilds durch Kurzinterviews, teilnehmende Beobachtung | |||
*Erprobung der Akzeptanz neuer Leistungsmerkmale oder einer neuen Leistungsqualität im kleinen Rahmen direkt am Veranstaltungsgeschehen vor der Übernahme auf das gesamte Event (oder dem Verwerfen) → Möglichkeit zur konkreten Ausgestaltung von Change Management bzw. Change Kommunikation | |||
===Anpassung veranlassen=== | ===Anpassung veranlassen=== | ||
*Anpassung von Funktion und Kapazität technischer Kommunikationsinfrastruktur (als Rückgrat der Personal- und Besucherkommunikation) für Besucher und verantwortliche Akteure | |||
===Interorganisational kooperieren=== | ===Interorganisational kooperieren=== | ||
*in das Qualitätsmanagement sind mittels Stakeholder-Kommunikation auch Unterstützungskräfte (BOS, Ämter) als wesentliches Sicherheits- und Qualitätsmerkmal einer Veranstaltung mit einzubeziehen | |||
*zuverlässige Bedienung etablierter Kommunikationsketten und Abstimmung gemeinsamen Handelns | |||
*Interorganisationale Kooperation ist für Personal auf Gelände gleichzeitig auch gemeinsamer Einsatz mit Kräften anderer Akteure und daher auch eine Form der koordinierten Problembewältigung | |||
==Finanzen managen== | ==Finanzen managen== | ||
*fortwährenden Kontakt zu Stakeholdern wie Banken halten | |||
*enge Zusammenarbeit mit eigener Buchhaltung<ref>für weiterführende Informationen zum veranstaltungsbezogenen Rechnungswesen siehe z. B. Klein, C.: ''Eventmanagement in der Praxis''. Bonn: interna 2008.</ref> | |||
*regelmäßiger Austausch mit Dienstleistern | |||
*''wichtigste Medien: E-Mail, Telefon, F2F-Kommunikation, Software-Plattformen, (integrierte) Messenger-Dienste'' | |||
==Veranstaltungsordnung managen== | ==Veranstaltungsordnung managen== | ||
[[Datei:ANNA20130730 (174).JPG|200px|thumb|right|Personal des Sicherheitsdienstes auf der Annakirmes 2013]] | |||
[[Datei:BM20130929 (140).JPG|200px|thumb|right|Übersichtsplan vom Start- und Zielbereich des Berlin Marathons 2013]] | |||
[[Datei:CRS2013 (51).JPG|200px|thumb|right|Geländeplan und Verhaltensregeln des Chiemsee Reggae Summer 2013]] | |||
[[Datei:WOA20130731 (236).JPG|200px|thumb|right|Infoboard auf dem Wacken Open Air 2013]] | |||
*Schwerpunktaufgabe des Sicherheitsdienstes, unterstützt von Brandsicherheitswache, Sanitätsdienst, Veranstalterpersonal und ggf. Lotsen | |||
*Veranstalter als kommunikative Schnittstelle zur Aufrechterhaltung des Informationsflusses | |||
*Einsatz von Tools des Personalmanagements sowie von Softwarelösung zum Veranstaltungsmonitoring mit kommunikativen Schnittstellen zu Akteuren und Besuchern | |||
*Aktualisierung und Abgleich von Lageinformationen | |||
*Einrichtung einer Koordinierungsgruppe (Gesprächsrunde mit Vertretern aller sicherheitsrelevanter Akteure) | |||
*Kommunikativ insbesondere: hinreichende Beschilderung auf dem Veranstaltungsgelände und ggf. Einsatz von Videoleinwänden für aktuelle (Sicherheits-)Informationen | |||
*Wording: einfach ,eindeutig, verständlich, redundant | |||
*''wichtigste Medien: Durchsagetechnik, Social Media, Apps, Software-Plattformen, (integrierte) Messenger-Dienste'' | |||
===Sichern/überwachen/schützen=== | ===Sichern/überwachen/schützen=== | ||
*Hinweise auf vorgenommene Sicherheits- und Überwachungsmaßnahmen durch Beschilderung, Banner, Flyer, Tickets, sowie durch direkte Ansprache, Durchsagen oder Filme | |||
*Funktionierende, störsichere Kommunikation mit Leitstelle unbedingte Voraussetzung → redundante Auslegung | |||
===Eingreifen=== | ===Eingreifen=== | ||
*gezielte Ansprache betroffener Personen bei Eingriffen: Ankündigung und Erklärung geplanter Maßnahmen um Irritationen vorzubeugen | |||
*Möglichkeiten zum Dialog bieten | |||
*Orientierung an taktischer Kommunikation der Polizei → s. Unterstützen/Taktisch kommunizieren | |||
===Lotsen=== | ===Lotsen=== | ||
*Weitergabe von Richtungshinweisen und sonstigen Anweisungen an Besucher | |||
*Ankündigung und Erklärung von Maßnahmen | |||
*Kompetente Auskunft auf Fragen → entsprechende Personalplanung Voraussetzung | |||
*Beschilderung als zentrales Element der Kommunikation mit Besuchern → während Veranstaltung regelmäßig prüfen, ob: | |||
**Platzierung in ausreichender Anzahl und gut sichtbar | |||
**Angemessene Beleuchtung, Ausführung (Größe, Windabhängigkeit) sowie Positionierung | |||
**„Konkurrenz“ durch Bebauung des Veranstaltungsgeländes inklusive großflächiger (Leucht-)Reklame | |||
===Stimmung beeinflussen=== | ===Stimmung beeinflussen=== | ||
*Bemühung um einheitlichen, konsolidierten Informationsstand durch schnellstmögliche Weitergabe offizieller, abgesicherter Informationen | |||
*Einbezug von Plattformen wie Facebook und Twitter und Nutzung eigener App-Angebote mit Benachrichtigungsschnittstellen<br> | |||
*siehe auch [[Manage#Identit.C3.A4t_managen|Maßnahmen des Mood-Managements im Identitäts-Management]] | |||
===Ablaufkontinuität gewährleisten=== | ===Ablaufkontinuität gewährleisten=== | ||
*wiederholte Ausgabe aktueller Informationen über alle verfügbaren Medien | |||
*Kombination mit konkreten Verhaltensanweisungen (zu notwendigen Umwegen, Änderungen bei Ein- und Ausgängen etc.) | |||
===Interorganisational kooperieren=== | ===Interorganisational kooperieren=== | ||
*Schaffung idealer Bedingungen für Abstimmung des gemeinsamen Handelns aller beteiligten Akteure und Institutionen über Bedarf an und die Verfügbarkeit von Ressourcen (Material, Raum, Zeit, Ausführungsinstanzen)sowie allgemeine Lageinformationen | |||
*Vollständige Etablierung von Kommunikationsroutinen (Gefestigte Kenntnisse in der Benutzung der Kommunikationsinfrastruktur, geklärte Zuständigkeiten) | |||
===Lageinformationen weitergeben=== | ===Lageinformationen weitergeben=== | ||
*vor allem Aufgabe des Sicherheitsdienstes sowie ggf. anderer Kräfte des Veranstalters (bspw. Lotsen) | |||
*Weitergabe präzise Einschätzungen zu Besucherbewegung, -Stimmung und -Anzahl sowie zu Ressourcenbedarf und -Verfügbarkeit abgeben an zuständige Stellen → wichtige Voraussetzung für erfolgreiche Lagekonstruktion | |||
==Sanitätsdienst== | ==Sanitätsdienst== | ||
[[Datei:BM20130928 (198).JPG|200px|thumb|right|Sanitätsstation auf dem Berlin Marathon 2013]] | |||
*Bereitstellung medizinischer Lösungen bzw. Hilfe für Betroffene → Hauptzielgruppe für externe Kommunikation des Sanitätsdienstes ist Veranstaltungspublikum, in Not-/Krisenfällen auch Veranstalter, Feuerwehr oder Polizei → siehe [[Sicherheitsbausteine/Kommunikationskonzept#Krisen-_.2F_Schadensbetrieb|''Krisenbetrieb in der internen Kommunikation'']] sowie [[Sicherheitsbausteine/Kommunikationskonzept#Krisen-_.2F_Schadensbetrieb_2|''Krisenbetrieb in der externen Kommunikation'']] | |||
*''wichtigste Medien: F2F-Kommunikation, Telefon, Funk, Software-Plattformen, (integrierte) Messenger-Dienste'' | |||
===Bereithalten=== | ===Bereithalten=== | ||
*Besprechungen über aktuelle und erwartete Lage sowie intra- und interorganisationale Pausengespräche | |||
*Einsatzplanung und Organisation von Personal | |||
*Nutzung von Lagekarten (Softwarebasis, Tafeln etc.) zur interorganisationalen Lagekonstruktion | |||
*Idealerweise vertiefende Abstimmungen gemeinsamer Handlungsweisen oder gezielt erfolgende Erfahrungsaustausche im Sinne von Know-How | |||
===Patrouillieren=== | ===Patrouillieren=== | ||
*Zeigen der Präsenz und Bereitstellung von Hilfe | |||
*Schwere Ansprechbarkeit von Besuchern als besondere kommunikative Herausforderung → Freundlichkeit, Respekt, Ruhe und Gelassenheit sowie ggf. Bestimmtheit unabdingbar | |||
*Bei Widerstand ggf. interorganisationale Kooperation mit Sicherheitsdienst oder Polizei nötig | |||
*Fragen und Auskünfte sind kompetent zu beantworten oder an entsprechende Stellen zu verweisen | |||
*Vorbeugende Hinweise zu Drogen, Alkohol, Schutz vor zu viel Sonne, Erstversorgung z.B. bei Schnittwunden etc. auch über Soziale Medien oder Video- und Audiobotschaften an der Bühne ausgegeben werden. | |||
===Patienten medizinisch versorgen=== | ===Patienten medizinisch versorgen=== | ||
*beruhigende und aufrichtig informative Kommunikation während der (Erst-)Versorgung sowie höfliche Bitte um Rücksichtnahme oder Unterstützung (z.B. für das Halten von Decken oder Planen zum Abschirmen der Maßnahmen) an Umstehende<br> | |||
*geeignete Kommunikationsformen: Face-to-Face-Gespräche, Telefonate | |||
===Interorganisational kooperieren=== | ===Interorganisational kooperieren=== | ||
*Hilfe durch Ordnungsdienst bei widerständigen Patienten anfordern | |||
*Information anderer Akteure bei interorganisationalen Lagebesprechungen (z.B. zu Patientenaufkommen, besonderen Fälle etc.) | |||
*Verzeichnung vorhandener Ressourcen und aktueller Ereignisse in kontinuierlich vollzogenen Lagekonstruktion (z.B. mittels überorganisational verwendeter Software) | |||
*Ggf. Informierung von Presse bzw. Öffentlichkeit (mittels Pressemitteilungen und -konferenzen, Kurzinformationen auf oder sozialen Medien, Telefon, Fax oder E-Mail) mithilfe von vorbereiteten Textbausteinen | |||
===Lage konstruieren=== | ===Lage konstruieren=== | ||
*gemeinsame Kontrollgänge über Gelände und ggf. Unterstützung durch entsprechende Software | |||
*Kommunikation mit Leitstelle analog zu Ordnungsdienst, regelmäßiger Statusbericht als Update für allgemeine Lageeinschätzung | |||
*Lagekonstruktion sowie periodische Lagebesprechungen zu Vorfällen und Verhältnissen auf dem und um das Veranstaltungsgelände | |||
==Einzelnachweise== | |||
<references /> | |||
---- | |||
''Autor: Toni Eichler (Universität Siegen)'' | |||
Aktuelle Version vom 21. Juni 2015, 18:34 Uhr
Dem Veranstalter als hauptverantwortlichem Akteur obliegen in der Eventphase zentrale kommunikative Aufgaben. Neben der Unterweisung und Koordinierung eigener sowie beauftragter Kräfte gilt es insbesondere, einen steten Informationsaustausch mit den eingesetzten BOS und den Besuchern zu etablieren sowie aufrecht zu erhalten, um ein aktuelles und einheitliches Lagebild an allen erforderlichen Stellen gewährleisten zu können. Bei der Durchführung einer Veranstaltung sind also nicht nur interne, sondern auch externe Kommunikationsobligationen zu beachten.[1] Darüber hinaus darf zu keinem Zeitpunkt der Informationsbedarf der Besucher außer Acht gelassen werden, der gemeinsam mit gezielten Maßnahmen des Mood-managements[2] ein wichtiger Ansatzpunkt für die Beeinflussung der Stimmung und damit für die Gewährleistung der Veranstaltungssicherheit ist. Anregungen können und sollten in diesen Punkten auch aus einschlägiger Literatur zur Event-Kommunikation[3] bezogen werden. Die zentralen Aufgaben des Veranstalters in der Eventphase sollen im weiteren Verlauf für eine strukturierte Darstellung der jeweiligen Kommunikationsobligationen und -Möglichkeiten als Orientierungspunkte dienen.
| Wer | Mit Wem | Was | Wie | Mit welchem Effekt |
|---|---|---|---|---|
| Veranstalter | BOS (Polizei Feuerwehr Rettungsdienst...) |
Abstimmung, Koordination, Planung, (Lage-)Informationen, Risikoeinschätzung | Maßnahmen Besprechungen, Treffen, Vor-Ort-Termine, Soft- und Hardwarelösungen Medien F2F-Kommunikation, Telefon, Funk, Durchsagen, E-Mail, Software-Plattformen[4], (integrierte) Messenger-Dienste |
geteilte, aktuelle Lageinformation, Gewährleistung der Veranstaltungssicherheit |
| Veranstalter | Dienstleister Eigenes Personal Ordnungsdienst Brandsicherheitswache Sanitätsdienst |
Organisatorische Belange, Informationen zur Veranstaltungsordnung, Koordination, (Lage-)Informationen | Maßnahmen Besprechungen, Treffen, Vor-Ort-Termine, Soft- und Hardwarelösungen Medien F2F-Kommunikation, Telefon, Funk, Durchsagen, E-Mail, Software-Plattformen, (integrierte) Messenger-Dienste |
geteilte, aktuelle Lageinformation, Gewährleistung des Veranstaltungsablaufs, effiziente Koordination von Arbeitskräften |
| Veranstalter | Besucher | Identitätsmanagement, Informationen zur Veranstaltungsordnung, Mood-management | Maßnahmen Events & Aktionen, Merchandising, Durchsagen, Befragungen, Studien, Beacons[5] Medien Print, TV, Radio, Social Media, Blogs, Foren, E-Mail, Megafon, Apps, SMS, Beschilderung, Banner, Flyer, Videowalls |
informierte Besucher mit erhöhter Selbstkompetenz, Sicherstellung eines geregelten Veranstaltungsablaufs |
Identität managen
- Image von Veranstalter und Veranstaltung als Faktor für Veranstaltungssicherheit: Gilt Festival/Kirmes/Sportevent als sicher?
- Sicherheitsgefühl beim Besucher zentrales Element für tatsächliche Sicherheit → Maßnahmen des Mood-Managements durch Veranstalter durchzuführen:
- Einbindung der Künstler in die Veranstaltungskommunikation: direkte Ansprache der Besucher durch Künstler, bspw. zu positiven Erfahrungen mit der Veranstaltung
- freundliches und hilfsbereites Personal, das das Gefühl vermittelt, gut aufgehoben zu sein
- weitestmöglich offene und aktuelle Informierung der Besucher zu Begebenheiten, Entwicklungen, Vorhaben
- redundante Verweise auf möglicherweise vorhandene Sicherheitszertifikate von Veranstalter und/oder Veranstaltung
- Gezielter Einsatz von stimulierenden sowie entspannenden Medien (bspw. Musik), um auf die Besucherstimmung Einfluss zu nehmen
- Identitätsmanagement besteht aus mehr als PR und Marketing, es ist ein Instrument zur aktiven Konstruktion von Sicherheit
- wichtigste Medien: Social Media, TV, Radio, Print
Networken
- Kontakte mit lokalen und überregionalen Medien, zur Sensibilisierung der Besucher gegenüber Sicherheitsthemen → Veranstaltungsinformationen immer auch Sicherheitsinformationen
- Profilierung als sicherheitsbewusster Veranstalter bzw. sicherheitsbewusste Veranstaltung auch gegenüber einer breiteren Öffentlichkeit
- Kontakt mit Stakeholdern, Unternehmen und Kommunen zur Organisation von Budgets, Incentives und sonstigen Hilfestellungen zur Förderung von Sicherheits-PR auf dem und um das Veranstaltungsgelände
Betreiben von Marketingmaßnahmen
- Customer-Relationship-Management (CRM)[6], Corporate Identity und Merchandising als Instrumente für Sicherheitsbotschaften[7]:
- Notfallkontakte, Warnungen und Orientierungshilfen auf Plakaten, Bannern, Tickets und in den sozialen Medien
- gezielte Nutzung von Social Media Kanälen um deren Reichweite zu erhöhen und so in Notfällen ggf. mehr erreichen zu können
- Veranstaltungsbezogene Audio- und Video-Botschaften mit Sicherheitsthemen kombinieren bzw. flankieren
- Nutzung aller Möglichkeiten zur Inszenierung der temporären Veranstaltungsgemeinschaft als sicherheitsbewusste Gemeinschaft
- Nutzung aller Möglichkeiten zur aktiven Einbindung der Besucher und Steigerung deren Selbstkompetenz:
- gemeinsame Sicherheitsübungen zu Beginn des Events (analog zu Flug- und Seereisen)
- Einbindung von Besuchern durch Hilfstätigkeiten und (Gewinn-)Spiele mit Incentives
Marke entwickeln
- Nachhaltige Positionierung der Veranstaltungsmarke: Sicherheit als Mehrwert
- Lokale Präsentation mithilfe von Zertifikaten etc. nachvollzieh- und nachprüfbar machen
Veranstaltungscharakter/Atmosphäre schaffen
- kompetentes Personal für Fragen von Besuchern vorhalten
- ausreichende Beschilderung aller sicherheitsrelevanten Einrichtungen (Notausgänge, Sanitätsstationen, Feuerwehrwachen, Mobile Polizeiwachen usw.)
- Beleuchtung der Beschilderung
Personal managen
- Steuerung eigener Kräfte sowie Koordinierung von Ordnungs-, Sanitätsdienst und Brandsicherheitswache sowie weiterer Dienstleister
- Einsatz von Softwarelösungen zum Veranstaltungs- bzw. Projektmanagement mit Messaging-Schnittstellen, Logbuchfunktion und Rückfallebenen → Unterstützung bei der gerichtsfesten Dokumentation eigenen Handelns
- Gebot eindeutiger und verständlicher Formulierungen
- wichtigste Medien: F2F-Kommunikation, Telefon, Funk, Software-Plattformen, (integrierte) Messenger-Dienste
Unterweisen
- adäquate Vorbereitung des Personals auf jeweilige Aufgaben durch verbindliche Verwendung einheitlicher, eindeutiger und klarer Begrifflichkeiten während der Veranstaltung
- Verwendung eines permanenten Feedback-Kanals für Rückfragen
- „Fehlerkultur“: falsches Verhalten nicht sanktionieren, sondern Eigenständigkeit und Selbstlernkompetenzen gezielt fördern
Motivieren
- nachhaltige Festigung sicherheitsbewussten Verhaltens durch:
- angenehmes Arbeitsklima
- o. g. Fehlerkultur sowie dezidiertes Fehlermanagment:
- gemeinsame Besprechung von Fehlverhalten oder –Entwicklungen
- Einsammeln von Verbesserungsvorschlägen aus der Belegschaft
- Rückinformation an Personal über die daraus resultierenden Veränderungen
- Anreize schaffen für besonders vorbildliches Verhalten
Einsetzen
- Kriterien für aus sicherheitskommunikativer Sicht adäquaten Personaleinsatz:
- individuelle kommunikative und informationelle Fähigkeiten
- Erfahrung u. Kenntnisse der örtlichen Begebenheiten (evtl. Einsatz von Lotsen)
Anpassen
- verlässliche Push- und Pull-Informierung der beteiligten Akteure zu aktuellen Entwicklungen
- aktuelle Besucher-Information zu laufenden Anpassungen
Entwickeln
- Change Management und Change Kommunikation bspw. durch:
- Mentoring-Modelle (gemeinsamer Einsatz von unerfahrenem und erfahrenem Mitarbeiter)
- Beteiligung des Personals an Konzeptentwicklung und Evaluation mittels Umfragen, Interviews usw.
- Testen neuer Qualitätsmerkmale → Testen
Qualität managen
- Evaluation vollzogener Maßnahmen durch:
- Enge Verzahnung der kommunikativen Schnittstellen von eigenem Personal und (Sicherheits-)Dienstleistern
- Erhebung von Besuchermeinungen mithilfe von Fragebögen, Interviews sowie Testszenarien
- Einbindung eigenen Personals → Entwickeln
- wichtigste Medien: Software-Plattformen, (integrierte) Messenger-Dienste, Funk, Telefon, Social Media, Apps, Foren
Lage konstruieren
Der Prozess der Lagekonstruktion verwendet bewusst den Begriff konstruieren. Alle Verantwortlichen müssen sich fortwährend vergegenwärtigen, dass das jeweils aktuelle Lagebild keine objektive Gegebenheit unter Berücksichtigung aller relevanten Faktoren ist, sondern eine von i.d.R. mehreren Akteuren unternommene Konstruktion. Eine vollkommene Reziprozität mit den tatsächlichen Gegebenheiten wird sich dabei kaum erreichen lassen, jedoch können die folgenden Punkte hilfreich für eine Annäherung sein:
- Vernetzung aller relevanten Akteure mit Veranstalter als Koordinierungszentrum → idealerweise permanent besetzte Leitstelle mit Vertretern aller Akteure
- wechselseitige Informationsweitergabe nach den Prinzipien Bottom-Up und Top-Down (Beschaffung und Weitergabe aktueller Lageinformationen durch Personal auf dem Gelände (Lageinformationen weitergeben) sowie Sammlung, Verarbeitung, Auswertung und Rückspiegelung in Form von Benachrichtigungen und Anweisungen durch Veranstalter)
- unterstützender Einsatz von Softwarelösungen zur Vernetzung und Dokumentation des Veranstaltungsmanagements
- relevante Kenngrößen sind z. B. Wetter, Besucheranzahl und -Bewegung, Stimmung, Verfügbarkeit von Ressourcen
Messen der Leistungsqualität
- fortlaufendes Controlling der Qualität angebotener Leistungen sowie Zusammenführung, Verarbeitung und Auswertung der erhobenen Daten beim Veranstalter in den Bereichen: Ressourcenqualität, Warteschlangenzeiten, Besucherzufriedenheit sowie Qualität von Dienstleistern, ggf. Künstlern, BOS
- Umsetzbar mit Überprüfungen, Befragungen usw.
Testen
- Einholen eines aktuellen Meinungs- bzw. Stimmungsbilds durch Kurzinterviews, teilnehmende Beobachtung
- Erprobung der Akzeptanz neuer Leistungsmerkmale oder einer neuen Leistungsqualität im kleinen Rahmen direkt am Veranstaltungsgeschehen vor der Übernahme auf das gesamte Event (oder dem Verwerfen) → Möglichkeit zur konkreten Ausgestaltung von Change Management bzw. Change Kommunikation
Anpassung veranlassen
- Anpassung von Funktion und Kapazität technischer Kommunikationsinfrastruktur (als Rückgrat der Personal- und Besucherkommunikation) für Besucher und verantwortliche Akteure
Interorganisational kooperieren
- in das Qualitätsmanagement sind mittels Stakeholder-Kommunikation auch Unterstützungskräfte (BOS, Ämter) als wesentliches Sicherheits- und Qualitätsmerkmal einer Veranstaltung mit einzubeziehen
- zuverlässige Bedienung etablierter Kommunikationsketten und Abstimmung gemeinsamen Handelns
- Interorganisationale Kooperation ist für Personal auf Gelände gleichzeitig auch gemeinsamer Einsatz mit Kräften anderer Akteure und daher auch eine Form der koordinierten Problembewältigung
Finanzen managen
- fortwährenden Kontakt zu Stakeholdern wie Banken halten
- enge Zusammenarbeit mit eigener Buchhaltung[8]
- regelmäßiger Austausch mit Dienstleistern
- wichtigste Medien: E-Mail, Telefon, F2F-Kommunikation, Software-Plattformen, (integrierte) Messenger-Dienste
Veranstaltungsordnung managen
- Schwerpunktaufgabe des Sicherheitsdienstes, unterstützt von Brandsicherheitswache, Sanitätsdienst, Veranstalterpersonal und ggf. Lotsen
- Veranstalter als kommunikative Schnittstelle zur Aufrechterhaltung des Informationsflusses
- Einsatz von Tools des Personalmanagements sowie von Softwarelösung zum Veranstaltungsmonitoring mit kommunikativen Schnittstellen zu Akteuren und Besuchern
- Aktualisierung und Abgleich von Lageinformationen
- Einrichtung einer Koordinierungsgruppe (Gesprächsrunde mit Vertretern aller sicherheitsrelevanter Akteure)
- Kommunikativ insbesondere: hinreichende Beschilderung auf dem Veranstaltungsgelände und ggf. Einsatz von Videoleinwänden für aktuelle (Sicherheits-)Informationen
- Wording: einfach ,eindeutig, verständlich, redundant
- wichtigste Medien: Durchsagetechnik, Social Media, Apps, Software-Plattformen, (integrierte) Messenger-Dienste
Sichern/überwachen/schützen
- Hinweise auf vorgenommene Sicherheits- und Überwachungsmaßnahmen durch Beschilderung, Banner, Flyer, Tickets, sowie durch direkte Ansprache, Durchsagen oder Filme
- Funktionierende, störsichere Kommunikation mit Leitstelle unbedingte Voraussetzung → redundante Auslegung
Eingreifen
- gezielte Ansprache betroffener Personen bei Eingriffen: Ankündigung und Erklärung geplanter Maßnahmen um Irritationen vorzubeugen
- Möglichkeiten zum Dialog bieten
- Orientierung an taktischer Kommunikation der Polizei → s. Unterstützen/Taktisch kommunizieren
Lotsen
- Weitergabe von Richtungshinweisen und sonstigen Anweisungen an Besucher
- Ankündigung und Erklärung von Maßnahmen
- Kompetente Auskunft auf Fragen → entsprechende Personalplanung Voraussetzung
- Beschilderung als zentrales Element der Kommunikation mit Besuchern → während Veranstaltung regelmäßig prüfen, ob:
- Platzierung in ausreichender Anzahl und gut sichtbar
- Angemessene Beleuchtung, Ausführung (Größe, Windabhängigkeit) sowie Positionierung
- „Konkurrenz“ durch Bebauung des Veranstaltungsgeländes inklusive großflächiger (Leucht-)Reklame
Stimmung beeinflussen
- Bemühung um einheitlichen, konsolidierten Informationsstand durch schnellstmögliche Weitergabe offizieller, abgesicherter Informationen
- Einbezug von Plattformen wie Facebook und Twitter und Nutzung eigener App-Angebote mit Benachrichtigungsschnittstellen
- siehe auch Maßnahmen des Mood-Managements im Identitäts-Management
Ablaufkontinuität gewährleisten
- wiederholte Ausgabe aktueller Informationen über alle verfügbaren Medien
- Kombination mit konkreten Verhaltensanweisungen (zu notwendigen Umwegen, Änderungen bei Ein- und Ausgängen etc.)
Interorganisational kooperieren
- Schaffung idealer Bedingungen für Abstimmung des gemeinsamen Handelns aller beteiligten Akteure und Institutionen über Bedarf an und die Verfügbarkeit von Ressourcen (Material, Raum, Zeit, Ausführungsinstanzen)sowie allgemeine Lageinformationen
- Vollständige Etablierung von Kommunikationsroutinen (Gefestigte Kenntnisse in der Benutzung der Kommunikationsinfrastruktur, geklärte Zuständigkeiten)
Lageinformationen weitergeben
- vor allem Aufgabe des Sicherheitsdienstes sowie ggf. anderer Kräfte des Veranstalters (bspw. Lotsen)
- Weitergabe präzise Einschätzungen zu Besucherbewegung, -Stimmung und -Anzahl sowie zu Ressourcenbedarf und -Verfügbarkeit abgeben an zuständige Stellen → wichtige Voraussetzung für erfolgreiche Lagekonstruktion
Sanitätsdienst
- Bereitstellung medizinischer Lösungen bzw. Hilfe für Betroffene → Hauptzielgruppe für externe Kommunikation des Sanitätsdienstes ist Veranstaltungspublikum, in Not-/Krisenfällen auch Veranstalter, Feuerwehr oder Polizei → siehe Krisenbetrieb in der internen Kommunikation sowie Krisenbetrieb in der externen Kommunikation
- wichtigste Medien: F2F-Kommunikation, Telefon, Funk, Software-Plattformen, (integrierte) Messenger-Dienste
Bereithalten
- Besprechungen über aktuelle und erwartete Lage sowie intra- und interorganisationale Pausengespräche
- Einsatzplanung und Organisation von Personal
- Nutzung von Lagekarten (Softwarebasis, Tafeln etc.) zur interorganisationalen Lagekonstruktion
- Idealerweise vertiefende Abstimmungen gemeinsamer Handlungsweisen oder gezielt erfolgende Erfahrungsaustausche im Sinne von Know-How
Patrouillieren
- Zeigen der Präsenz und Bereitstellung von Hilfe
- Schwere Ansprechbarkeit von Besuchern als besondere kommunikative Herausforderung → Freundlichkeit, Respekt, Ruhe und Gelassenheit sowie ggf. Bestimmtheit unabdingbar
- Bei Widerstand ggf. interorganisationale Kooperation mit Sicherheitsdienst oder Polizei nötig
- Fragen und Auskünfte sind kompetent zu beantworten oder an entsprechende Stellen zu verweisen
- Vorbeugende Hinweise zu Drogen, Alkohol, Schutz vor zu viel Sonne, Erstversorgung z.B. bei Schnittwunden etc. auch über Soziale Medien oder Video- und Audiobotschaften an der Bühne ausgegeben werden.
Patienten medizinisch versorgen
- beruhigende und aufrichtig informative Kommunikation während der (Erst-)Versorgung sowie höfliche Bitte um Rücksichtnahme oder Unterstützung (z.B. für das Halten von Decken oder Planen zum Abschirmen der Maßnahmen) an Umstehende
- geeignete Kommunikationsformen: Face-to-Face-Gespräche, Telefonate
Interorganisational kooperieren
- Hilfe durch Ordnungsdienst bei widerständigen Patienten anfordern
- Information anderer Akteure bei interorganisationalen Lagebesprechungen (z.B. zu Patientenaufkommen, besonderen Fälle etc.)
- Verzeichnung vorhandener Ressourcen und aktueller Ereignisse in kontinuierlich vollzogenen Lagekonstruktion (z.B. mittels überorganisational verwendeter Software)
- Ggf. Informierung von Presse bzw. Öffentlichkeit (mittels Pressemitteilungen und -konferenzen, Kurzinformationen auf oder sozialen Medien, Telefon, Fax oder E-Mail) mithilfe von vorbereiteten Textbausteinen
Lage konstruieren
- gemeinsame Kontrollgänge über Gelände und ggf. Unterstützung durch entsprechende Software
- Kommunikation mit Leitstelle analog zu Ordnungsdienst, regelmäßiger Statusbericht als Update für allgemeine Lageeinschätzung
- Lagekonstruktion sowie periodische Lagebesprechungen zu Vorfällen und Verhältnissen auf dem und um das Veranstaltungsgelände
Einzelnachweise
- ↑ Dies gilt insbesondere im Krisenfall. Siehe hierzu Krisenbetrieb in der internen Kommunikation sowie Krisenbetrieb in der externen Kommunikation
- ↑ Zur Einführung: Batinic, B.; Appel M.: Mood Management. In: Medienpsychologie. Heidelberg: Springer Medizin 2008, S. 117-118. Weiterführend siehe z. B.: Oliver, M. B.: Mood management and selective exposure. In: Bryant, J.; Roskos-Ewoldsen, D.; Cantor, J. (Hg.): Communication and emotion: Essays in honor of Dolf Zillmann. New York: Routledge 2012, S. 85–106.
- ↑ Wünsch, U; Thuy, P. (Hg.): Handbuch Event-Kommunikation: Grundlagen und Best Practice für erfolgreiche Veranstaltungen. Berlin: Erich Schmidt 2007.
- ↑ vgl. http://www.uni-siegen.de/fb5/wirtschaftsinformatik/paper/2013/crisisprevention2013_sicherheitsarena.pdf
- ↑ Beacons sind kleine Sender, die auf dem Veranstaltungsgelände installiert und unabhängig vom Mobilnetz (via Bluetooth) situations- und ortsabhängige Nachrichten an Endgeräte von Besuchern und Einsatzkräften in einem bestimmen Umkreis (ca, 30m, abhängig von baulichen Gegebenheiten) übermitteln können.
- ↑ vgl. z. B. Bruhn, M.: Kundenorientierung: Bausteine für ein exzellentes Customer Relationship Management. München: C.H.Beck 2012.
- ↑ für allgemeine Hinweise zu veranstaltungsbezogenen Marketingmaßnahmen siehe z. B. Sokkar, S.: Eventmarketing - theoretischer Teil, in: Dannhäuser, R., Hrsg., Eventkommunikation. Stuttgart: Deutscher Sparkassen Verlag 2008, S. 15-42.; Schaumlöffel, M.: Marken erleben: Signalisation, Emotion, Interaktion und Information im Eventmarketing, ebd., S. 75-112 und Klein, C.: Eventmanagement in der Praxis. Bonn: interna 2008.
- ↑ für weiterführende Informationen zum veranstaltungsbezogenen Rechnungswesen siehe z. B. Klein, C.: Eventmanagement in der Praxis. Bonn: interna 2008.
Autor: Toni Eichler (Universität Siegen)